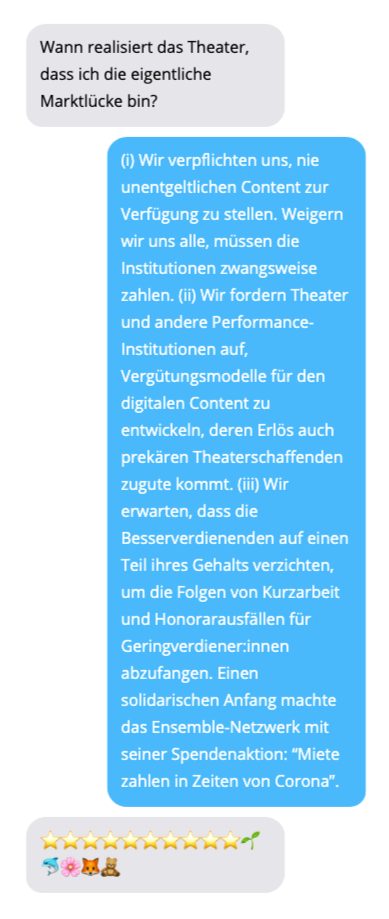Das Theater produziert Ausschlüsse – auch gegenüber jenen, die längst „drin“ sind. Dieser Text unseres Autor*innen-Duos entstand vor und während der Coronakrise. Die darin beschriebenen Zustände rund um das Theater haben sich seitdem zugespitzt. Eine Einordnung unternimmt der Glossarchat. 💜
Ich geh also zur Haltestelle, es ist ein ungewöhnlich heißer Morgen. Auf Insta poste ich CA Conrad unter Kirschbäumen.
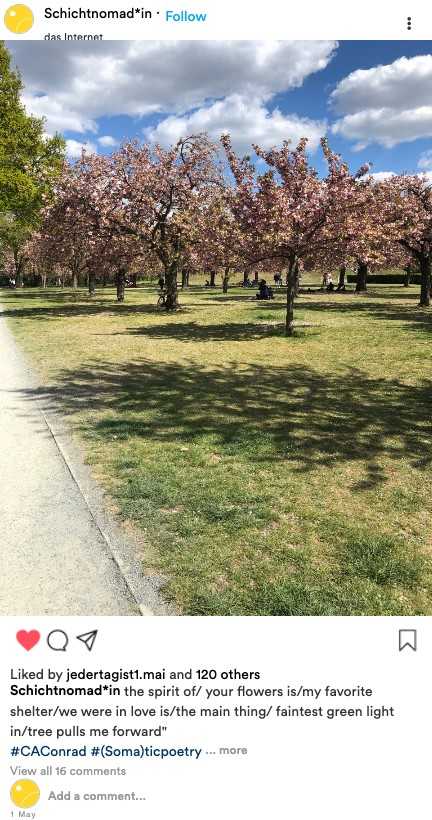
Ich frage mich, warum die Welt einfach in Wellen kommt, und ich nicht aus ihr heraus, als du mich plötzlich von der Seite anhaust. Du sagst: „Hey Buddy, lang nicht gesehen!“ Was soll’s, ich geh zu dir hin, schnapp mir einen alten Leporello und schenk dir ‘ne Insta-Story. Dann setze ich mich auf deine Eingangstreppen, schiebe meine Sonnenbrille ein klein wenig runter, und frage dich: „Real talk, Theater?“
Nur so viel: Ich lebte mit meiner Freundin in einer Großstadt und wir besaßen eine etwas renovierungsbedürftige Wohnung, in der immer wieder Handwerker vorbeikamen. Ich wechselte dann in den Slang, um die Jungs dazu zu bringen, uns nicht zu verarschen. Zwischen uns gab es keinen Smalltalk und keine tote Luft. Zu der Zeit erinnerte ich mich häufig an Annika. Sie hatte meine Freundin und mich kurz nach Neujahr per SMS zum Geburtstagsessen eingeladen – natürlich mit der Bitte um Buffetspende, da es sich um eine informelle celebration im hanseatischen Stil handele.
Ich ging mit meiner Tupperdose am Buffet entlang, sammelte Kuchenreste und Oliven und entschied mich für eine Flasche Veuve Clicquot Rosé, die ich auf eBay Kleinanzeigen für vierzig Euro verkaufen würde.
In ihrem Altbau nahe der Alster ließ uns die Gutbürgerlichkeit relativ schnell Kontakt zu Gästen finden. Wir versackten schließlich bei einer Fünfergruppe, der Jüngste von ihnen war etwa fünfzehn Jahre älter als wir. „Ich lese ja nicht viel, aber wenn ich lese, will ich, dass das Buch schon wahr ist“, sagte Elena. Wang, ein gutaussehender Headhunter auf Durchreise, warf ein, dass wir uns in einem Zeitalter der Neuen Sachlichkeit befänden, und dass die Undurchsichtigkeit der Kunst Kalkül sei, um uns unsere Mangelhaftigkeit zu vergegenwärtigen. Er erläuterte diesen Sachverhalt mit Verweisen auf Informatik und Botanik, woraufhin ihn Stefanie, die rot gekleidete NLP-Trainerin, fragte, wo er denn sein ganzes Wissen herhabe, es sei ja erstaunlich, dass er sich in der Naturwissenschaft ebenso leichtfüßig bewege wie in der Kunst. „Ich lese“, sagte Wang, „von klein auf.“
Die „Fett auf mager“-Technik
Kurz danach erzählte die Frau des anthroposophischen Kinderarztes, sie habe sich in den Morgenstunden, also den Schulstunden ihrer zwei Kinder, viel mit der Impasto-Technik auseinandergesetzt. In der Ölmalerei bestimme die „fett auf mager“-Regel das Handwerk. Das Bild werde mit einer mageren Malweise begonnen, um anschließend die nachfolgenden Farbschichten immer ein wenig fetter zu malen. Um jede einzelne Farbschicht akkurat auftragen zu können empfehle sich ein Balsam-Terpentinöl, das ihr Mann extra aus Nicaragua mitgebracht habe. Wang warf ein, dass er auch schon Erfahrung mit Dammarharz gemacht habe und, dass er die Halbdeckende Maltechnik der Impastotechnik bevorzuge.
Ich dachte an einen großen Scheißhaufen auf Leinwand, den man dünnschichtig aufträgt, an eine marmorne Wachsfigur, der man Exkremente aus dem Arsch zieht, um das Zeitalter der Neuen Befindlichkeit einzuleiten. „Fürwahr hat sich die Verbindung von Fäkal- und Arbeiterkultur erst mit der bürgerlichen Abgrenzung zum Vulgarismus etabliert“, könnte ich in einer Rolle als Magd irgendwo in Süddeutschland auf einem der etwas schrägen Virtual-Reality-Mittelaltermärkte im Jahr 2050 dozieren. „Die Konsequenz war unerbittlich“, würde ich predigen. „Die Worte von Plebs und Pöbel wurden ausgemistet, nur um dann im intimsten Raum, nämlich dem Bett, im nächtlichen Dirty Talk, das Begehren nach Sprachfreiheit im Rollenspiel zu kultivieren.“ „Ich will das Wort, aber nur im Fick“, sagte ich stattdessen im Real Life. „DAS gibt es ja bereits von Kiki Smith“, sagte Wang. „1996 im MoMA.“ Das Gespräch plätscherte dann nach einem langen Monolog über die psychoanalytische Deutung von Exkrementen so vor sich hin. Ich ging mit meiner Tupperdose am Buffet entlang, sammelte Kuchenreste und Oliven und entschied mich für eine Flasche Veuve Clicquot Rosé, die ich auf eBay Kleinanzeigen für vierzig Euro verkaufen würde.

Genau drei Wochen später fuhr ich mit dem Dramaturgen eines Hauptstadttheaters von Berlin nach Hamburg. Wir waren uns zufällig am Bahnsteig begegnet und gaben uns gegenseitig das Gefühl, uns zu mögen. Unausgesprochen einig setzten wir uns dann auch hintereinander auf die Fensterplätze. Der Dramaturg streckte seinen Kopf nach hinten und sagte:
Also so einfach würde das bei Dramaturgiesitzungen ja nicht zugehen.
Was?
Na, die Konsensfindung.
Ihr diskutiert viel?
Nein, das ist ja das Problem.
Kurz vor Ludwigslust wurden wir kontrolliert. Der Dramaturg zog eine Bahncard 100 aus seinem FREITAG-Etui, ich hielt meinen Super Sparpreis unter das Lesegerät. Er erzählte mir von dem Kunstfestival, das im Februar und März in seinem Theater stattfinden würde und sich mit den Themen Heimat, Zugehörigkeit und Feminismus auseinandersetze. „Auch der Hauptstadtkulturfonds ist beteiligt“, sagte er nicht unstolz.
Ich suche im Übrigen noch ein:e Hospitant:in. Jemanden, der mir bei der Organisation für die Konferenz hilft. Am besten eine:n, der/die bereits einen Bachelor hat.
Für wie lange?
Drei bis vier Monate.
Bezahlung?
Na ja, bislang nichts. Aber wir versuchen, noch Geld zu finden.
50 Euro vom Regisseur
Ich schrecke von der Treppe hoch. Deswegen gibt es mich hier außerhalb von dir, und deswegen rannte ich mit dreizehn Jahren jeden Dienstag und Donnerstag zu Sun-Express, um nur einigermaßen andeuten zu können, dass auch ich es in den sechs Wochen Ferien über die Stadtgrenzen hinaus geschafft hatte. Ganz wie zu Oberstufenzeiten, als ich Fremdwörter in Deutschklausuren unter meinen rechten Unterschenkel schob, weil ich meinte, big words würden über Klassenunterschiede hinwegtäuschen.
Ich rutsche auf der Treppe hin und her. Ich weiß, dass hier einiges im Argen liegt. Bislang verschlossen wie Polly Pocket, aber offensichtlich, und so gar nicht flüchtig. Ich erinnere mich daran, wie ich damals bei meiner ersten, fast dreimonatigen Hospitanz an einem der größten Stadttheater Deutschlands auf der Couch einer Freundin lebte und nachts in einer Bar arbeitete, um mir bei den Proben anhören zu müssen, ich sähe jeden Tag so müde aus. Wie ich mir für die Salzburger Festspiele Geld lieh, und trotzdem bei den allabendlichen Gemeinschaftsabendessen vorschob, ich müsse noch etwas für die Uni machen, nur um dann in der Herbergsküche Spaghetti zu kochen. Wie mir ein Regisseur 50 Euro mit der Begründung zusteckte, ich solle mir davon neue Sneaker kaufen.
Ich erwartete dich als Jüngling, Theater, und fand einen Saab 900 Turbo mit Lammfell auf dem Beifahrersitz, Sylt- und Anti-AKW-Aufkleber auf der Heckscheibe.
Ich erinnere mich daran, wie ich meinen Eltern erklärte, was ein:e Dramaturg:in sei. Wie sie meine Premiere verpassten, weil sie sich nicht trauten, einen Raum zu betreten, den sie nicht lesen können. Weil sie meinen, man müsse verstehen. Wie ich wusste, dass sie sich keine Restkarte für 40 Euro leisten können, weil ich mir erst letztens von ihnen Geld geliehen habe. Für das Theater. Wie das Gespräch zwischen einer Theaterkritikerin und mir abrupt endete, als ich sie fragte, ob man in Gießen Theaterregie studieren könne. Wie ich einst log, ich hätte die selbstreferentielle Ebene im letzten Pollesch-Stück natürlich als einen Verweis auf Sophie Rois verstanden. Zwei Tage zuvor spuckte Google aus, dass Sophie Rois Schauspielerin sei. Wie ich mir heimlich abguckte, souverän durchs Theaterfoyer zu gehen, um ja nicht kleinklein preiszugeben, dazugehören zu wollen. Wie schräg das Lächeln zweier Dramaturgen war, als ich erzählte, ich hätte mich lange nicht getraut im Theater Fuß zu fassen, weil ich mir nicht vorstellen hätte können, dass auch ich Künstlerin sei. Wie ich von all den Codes ja nichts wusste, damals als ich die Schokolade von meinem Finger leckte und „She’s Got That Light“ von Orange Blue als Titelmusik von „Arabella“ mitsummte, während meine Mutter stumm im Wohnzimmer bügelte. Bis ich ihr einfach an diesem heißen Sommertag sagte: „Ich möchte ein Theaterstück schreiben“ und sie, die Dunstwolke des Bügeleisens wegschubsend, einfach so antwortete: „Es gibt Dinge, die sind nicht für uns.“
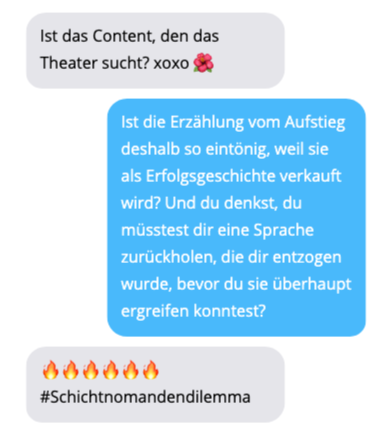
Was aber hätte ich von dir erwarten können? Ich erwartete dich als Jüngling, der den spirit der überlegten Ekstase in einen Raum wirft, kritisch, queer, weich und liebevoll, ein wenig anhänglich, aber nie vertraut, immer ein wenig auf Abstand, immer kunstvoll, selten befindlich, nature und nurture, darf ich vorstellen: Argonaut, halsbrecherisch, unerschrocken, unangepasst, durch die letzten und zukünftigen Jahrhunderte schlitternt. Ich erwartete dich als Jüngling, Theater, und fand einen Saab 900 Turbo mit Lammfell auf dem Beifahrersitz, Sylt- und Anti-AKW-Aufkleber auf der Heckscheibe. Der bricht jedes Jahr Spielzeit-frisch auf, stapelt Konzepte, key words, Etiketten, Zuschauerzahlen als Einlegeware im Kofferraum, aber wenn es darum geht, nach draußen zu schauen und anzuhalten, am Wegesrand den Blick auf unwegsame Weite, ziehst du einfach weiter. Weil du verkennst, dass der Boden, auf dem du fährst, für andere nicht begehbar ist. Let’s face it: Trotz Wortejakulationen ist auf deinen Bühnen Realismus nie mehr als Illusion, sind deine Diskussionen immer künstlicher denn wahrhaftig. Theater, du bist nicht mehr als ein Anästhetikum.
Und ich, ich bin ein:e Schichtnomad:in, über die/den du nicht sprichst, über die/den du nie wirklich schriebst für deine große Bühne. Hängen zwischen den Milieus. Denn die/der Schichtnomad:in schält Herkunft ab für den Aufstieg, um sich für dich schick zu machen. Aber jedes Mal mein Arbeiterherz erstechen, jedes Mal die Scham des Nicht-Wissens, des Nicht-Deutens, des Nicht-Kennens zu erleben, das hat mich einsam gemacht und rastlos, denke ich hier auf der Treppe als sich die Sonne hinter die Hausfassade schiebt. Weil man ja nicht alles ablegen kann, weil ja auch manches bleibt, sage ich zu dir und schaue auf deine Pforte. Dann zünde mir eine Zigarette an, und verschwinde irgendwann links hinterm Suhrkamp Verlag.