Das mittlere Theatertreffen-Wochenende stand ganz im Zeichen von Christopher Rüpings zehnstündigem Antikenprojekt „Dionysos Stadt“. Eine Ausnahmeproduktion, auch für uns. Lesen Sie hier unsere Kritik in vier Teilen – und noch so einiges mehr.
1. Teil: Prometheus. Die Erfindung des Menschen
Aus dem Notizheft
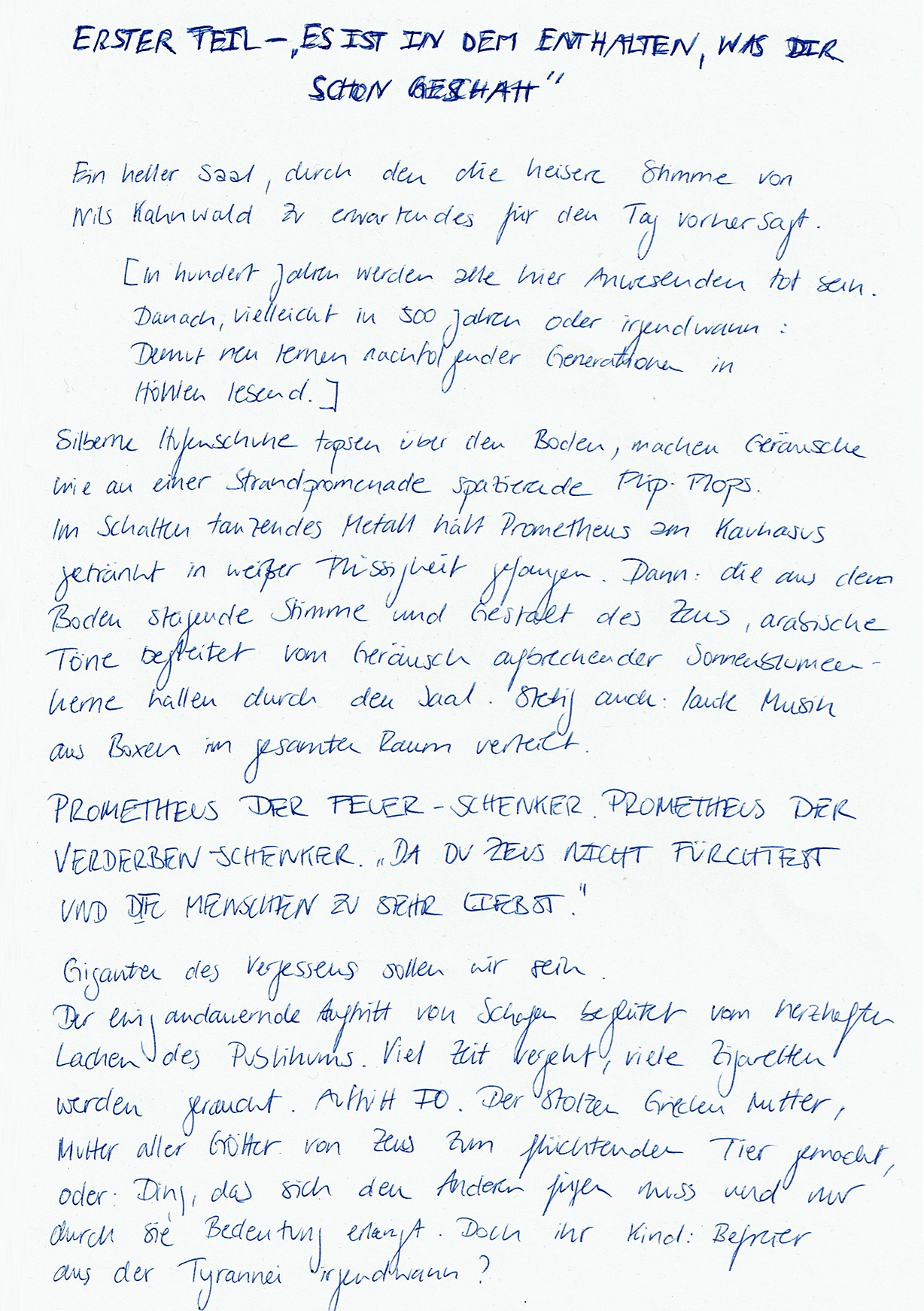
Ok, es fängt wohl an. Diese 10-Stunden-Sache beim Theatertreffen. „Wer ist jetzt schon enttäuscht, dass das Ganze hier so los geht?“, fragt Nils Kahnwald nach wenigen Minuten. Er nimmt den Erwartungen an einen sich selbst übertreffenden Auftakt den Wind aus den Segeln – kein den Mythen entsprechender Paukenschlag, kein Sich-Sophokles-aus-dem-Leib-Brüllen.
„Dionysos Stadt“ legt sogleich seine Behauptungen offen: Das hier ist ein Stück, und wir sind auch nur Menschen. Aber wir geben erst mal alles, ihr werdet sehen! Alle Karten sind auf dem Tisch: Die Bühne von Jonathan Mertz wirkt wie nicht fertiggebaut, das Licht bleibt an, die Spielenden hängen etwas verloren rum. Die Geschäftigkeit im Saal will sich nur langsam legen, die Erwartungen stehen in der Luft: Hier soll etwas Gemeinsames entstehen.
Was waren doch gleich… die Dionysien?
Als kultisches Spektakel zu Ehren des Gottes Dionysos im demokratischen Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr. etabliert, beinhalteten die Dionysien neben Chorgesängen und kultischen Ritualen auch einen Theaterwettkampf, bei dem verschiedene Tragödiendichter mit jeweils einer Tragödientrilogie und einem Satyrspiel gegeneinander antraten. Der gegenwärtige Forschungsstand deutet darauf hin, dass die Teilnahme an diesem mehrtägigen Theaterfestival eine bürgerliche Pflicht ausmachte, weswegen die überwiegend männlichen Bürger Athens finanziell für ihr Engagement bei den Dionysien honoriert wurden. Damit einhergehend lässt sich die Theatererfahrung im Athen des perikleischen Zeitalters freilich nicht mit der heutigen vergleichen – vor allen Dingen nicht, was die zeitliche Erfahrung betrifft:
Theater war nicht eine Option der Abendunterhaltung, ein kurzweiliger Genuss, dem man sich, nach verrichteter Arbeit, ein paar Stunden hingab, sondern im Gegenteil eine Versammlung an Menschen, die in ihren steinernen Amphitheatern mehr als zehn Stunden täglich drei Tragödien und ein Satyrspiel verfolgten, um schließlich einen Dichter als besonders fähig auszuzeichnen, mit seinem Drama zur gesellschaftlichen Verbesserung beizutragen. Von heute her betrachtet, mag es sich also lohnen, über die Re-Etablierung von Dionysien nachzudenken: Dass Theater Räume eröffnet, die das Potenzial für progressives Denken, für das Ersinnen von Zukunftsutopien in sich bergen, ist momentan schließlich gefragter denn je. Nicht, um unentwegt zu konsumieren, sondern um diverse Positionen zu diversen Themen – mittels verschiedener Inszenierungen – vermittelt zu bekommen und im Anschluss oder zwischendurch über das Gesehene unter sich und mit sogenannten Expert*innen dieser Themen zu diskutieren, sie weiterzudenken oder daraus Neues zu entwerfen. Aber auch um miteinander zu speisen, zu verweilen, zu sein.
Ein Theater, das sich als Institution einer Gesellschaft, als Bestandteil städtischen Lebens verstehen will, kann nicht nur ein Ort sein, der sich zu bestimmten Zeiten für bestimmte Menschen öffnet. Es birgt viel größeres Potenzial: Als ein Theater, das wie ein Gebäude fungiert, das den Blick in den freistehenden Horizont lenkt. Und: Wie großartig ist es bitte, dass Theater nicht nur einen ästhetischen und politischen Wert besitzt, sondern auch einen Raum für exzessive Unterhaltung bieten kann?
Prometheus tritt in hohen Ledersandalen auf, begibt sich sogleich in seinen Käfig. Der Vorausdenkende kennt die Zukunft: Er, der den Göttern das Feuer entwenden und den Menschen überbringen wird, wird 3000 Jahre an den Kaukasus gekettet sein. Als einziger Begleiter ist da ein Rabe, der von seiner Leber isst und von dessen Kot er sich ernährt, der mit seinen Ketten verwachsen wird, er wird erst nach weiteren abertausenden Jahren gerettet. Seine Zukunft besteht bei Christopher Rüping aus einem von der Decke baumelnden Eisenkäfig unter einer Dusche von weißer Farbe. Benjamin Radjaipour gibt Prometheus als Gott, dessen Würde ihm längst abhanden gekommen ist: „Jeden Fehler, den ich mache, kenne ich schon jetzt.“
Nur graduell nimmt das Licht ab und die Musik zu. In Zeitlupe und untermalt von elektronischem Streichersound kommt die Stimmung auf, die gemeinhin als Theater verstanden wird: Ein kollektives Zuhören im dunklen Raum, im Scheinwerferlicht die Sprechenden. Es entsteht der Theaterabend parallel zu seinen Figuren: Rüpings Gerüst ist ebenso offengelegt wie jenes metallene Gestell auf der Bühne. Die Zukunft besteht aus stage-diving, Nacktheit, Lärm und der Möglichkeit, bei grünem Licht auf der Ampel am Rande der Bühne auf dieser szenisch zu rauchen.

Das Publikum lacht über Witze, die noch nicht geschehen sind. Wer in einen Dialog mit 1100 Menschen treten möchte, braucht dazu keine Dominanz, es reichen die Fragen, die alle betreffen. „Wer denkt, dass er in fünfzig Jahren noch lebt?“ Ein gutes Drittel des Saals zeigt auf: Es ist jung, optimistisch oder beides. So simpel und tragisch kann Voraussagung sein: Dass dieser gesamte Saal in hundert Jahren nicht mehr leben wird, entbehrt nicht einer gewissen Traurigkeit. Aber wir sind ja auch in der Antike! Tragödie! Um Weltschmerz geht es ebenso wie um Toilettenpausen, und Nils Kahnwald meistert Poesie und Triviales leichtfüßig. Wie angesetzt entsteht ein epischer Moment im Theater: Vangelis‘ „Conquest of Paradise“ ist die Hymne zum Stage-Diving und zahlreiche Arme tragen Kahnwald durch das Haus der Berliner Festspiele.
Stimmen aus dem Publikum I
Als Zeus‘ Stimme auf Englisch und Arabisch aus der Unterbühne hervorschallt, wird die göttliche Wut auf Prometheus durch seinen Auftritt in Hoodie und Röckchen und Nüsse knackend abgeschwächt. Er will eine Antwort darauf, weshalb er den Menschen das Feuer gab: Majd Feddahs Zeus lässt immer wieder ein „why?“ entfliehen, er hat ja ein paar tausend Jahre Zeit. So ist der Auftritt von blökenden Schafen, Schauspieler*innen unter Felldecken, Verbildlichung der vergehenden Zeit (und die Gelegenheit, auf der Bühne eine zu rauchen). In vorauseilender Nostalgie geht es zwanzig Minuten nach dem Anfang um sein Ende: wie es sein wird, wenn es geschafft ist, wie sie sich nach zehn Stunden verbeugen werden, wie die Erinnerung an diesen Abend immer wieder aufkommen und schließlich verblassen wird. Doch jetzt ist ja gerade noch Gegenwart.
Vieles bleibt also wunderlich nach dem ersten Teil dieses Marathons. Hören wir, was ein echter Experte für die antiken Texte, der Berliner Altphilologe Michael Kardamitsis, zu sagen hat:
2. Teil: Troja. Der erste Krieg
Aus dem Notizheft
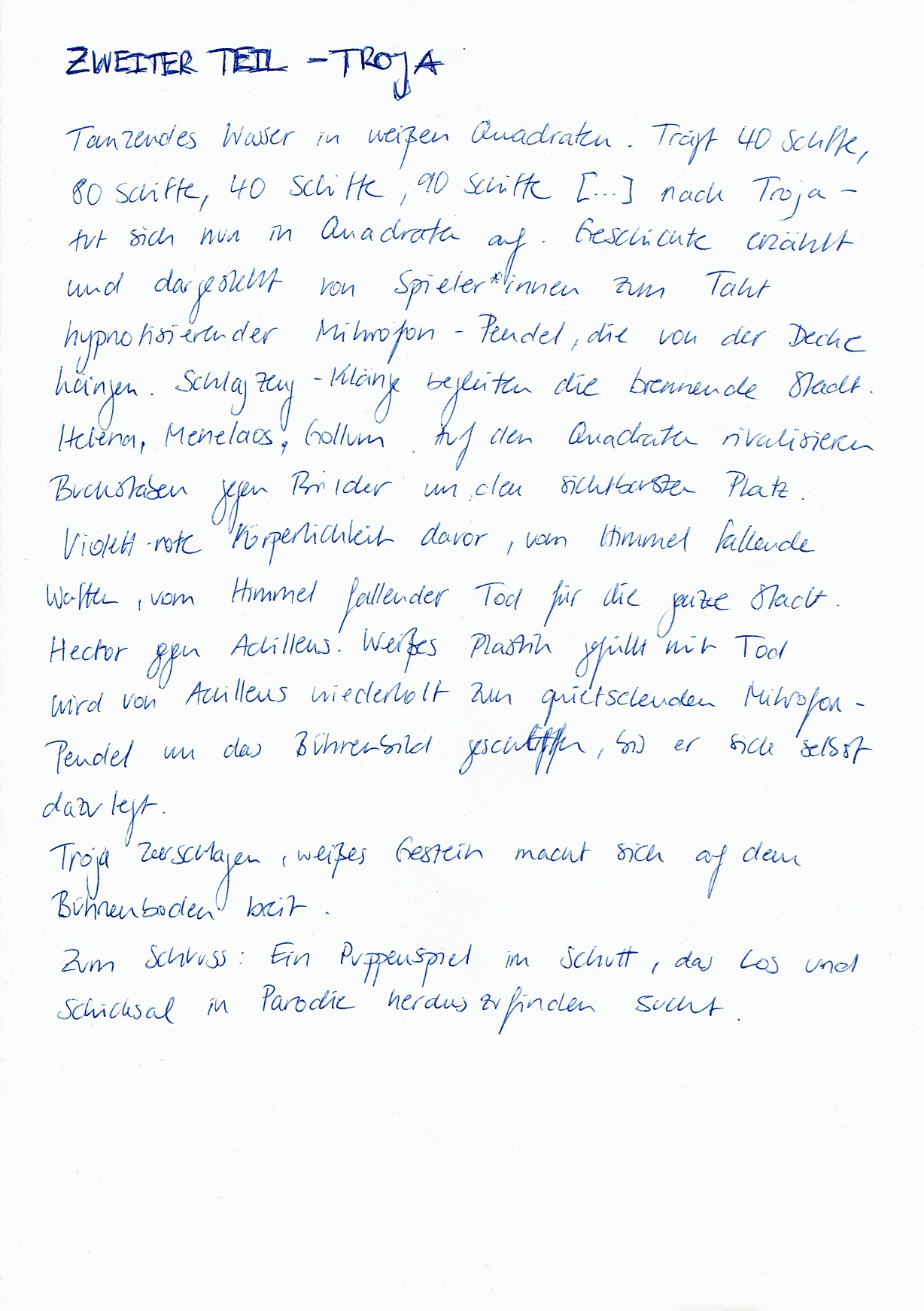
Im ersten Teil hatte es Zeus angekündigt: „You gave fire to the people. And they give you a war”, sagte er zu Prometheus. Und jetzt, nach der ersten Pause, wütet der Trojanische Krieg und Jochen Noch als Moira („das Schicksal“) steht in der Mitte der Bühne und rezitiert aus Homers „Ilias“. Es ist eine solch überbordende Liste von Schiffen und Kriegsführern, dass Noch von einem Bildschirm abliest: Dieser und jener von da und dort mit soundso vielen Schiffen im Gefolge. Minutenlang hört das Publikum nichts als Namen, Orte und Ziffern. Das ist konkret und unkonkret zugleich, weil hier ein großes Schlachtentableau entworfen wird, das aber seltsam ungegenständlich bleibt – zu viel ist es, das auf das Publikum einprasselt.

Der Krieg vermittelt sich vor allem als Rhythmus. Matze Pröllochs am Schlagzeug erzeugt einen Sound, der eintönig ist, ohne zu langweilen, wie ein zeitgenössischer Marsch. Das ist mitreißend, aber ohne Tragik. Wenn Wiebke Mollenhauer als Achill von den Schlachten berichtet, dann ist man weniger betroffen als von der Bühnenästhetik gefangengenommen. Wie die Schauspielerin hier gegen die Musik anbrüllt, wie sie sich mit dem ganzen Körper in diesen Text wirft, ist vor allem ein wirksamer Effekt, aber auch nicht viel mehr.
Stimmen aus dem Publikum II
Dass man dem erzählten Geschehen emotional fernbleibt, liegt auch an den riesigen Videoprojektionen von Susanne Steinmassl. Darin fliegt die Kamera durch fragmentierte Videospielwelten oder lässt antikisierende Büsten rotieren. Die Projektionsfläche ist eine Bühnen-Konstruktion von Jonathan Mertz aus quadratischen weißen Platten – eine Art Riesen-Tetris-Gebilde. Diese spielerische Anlage im Look der Inszenierung überträgt Regisseur Christopher Rüping auch auf das Schauspiel: Immer wieder legt es sich selbst als Spiel und Konstruktion offen – etwa durch kollektive „Hä?!?“-Ausrufe nach besonders komplizierten Textpassagen. Nach der „Ilias“ zoomt die Inszenierung auf Troja. Maja Beckmann, Gro Swantje Kohlhof und Wiebke Mollenhauer bestreiten dann „Die Troerinnen“ von Euripides zu dritt. Trotz ihres kraftvollen Spiels will hier der poetische Funke nicht so recht überspringen – zu dicht und lang ist dieser zweite Teil von „Dionysos Stadt“.
Unser Kritiker scheint nach dem zweiten Teil noch nicht vollends überzeugt. Was sagt der Experte?
3. Teil: Orestie. Verfall einer Familie
Aus dem Notizheft
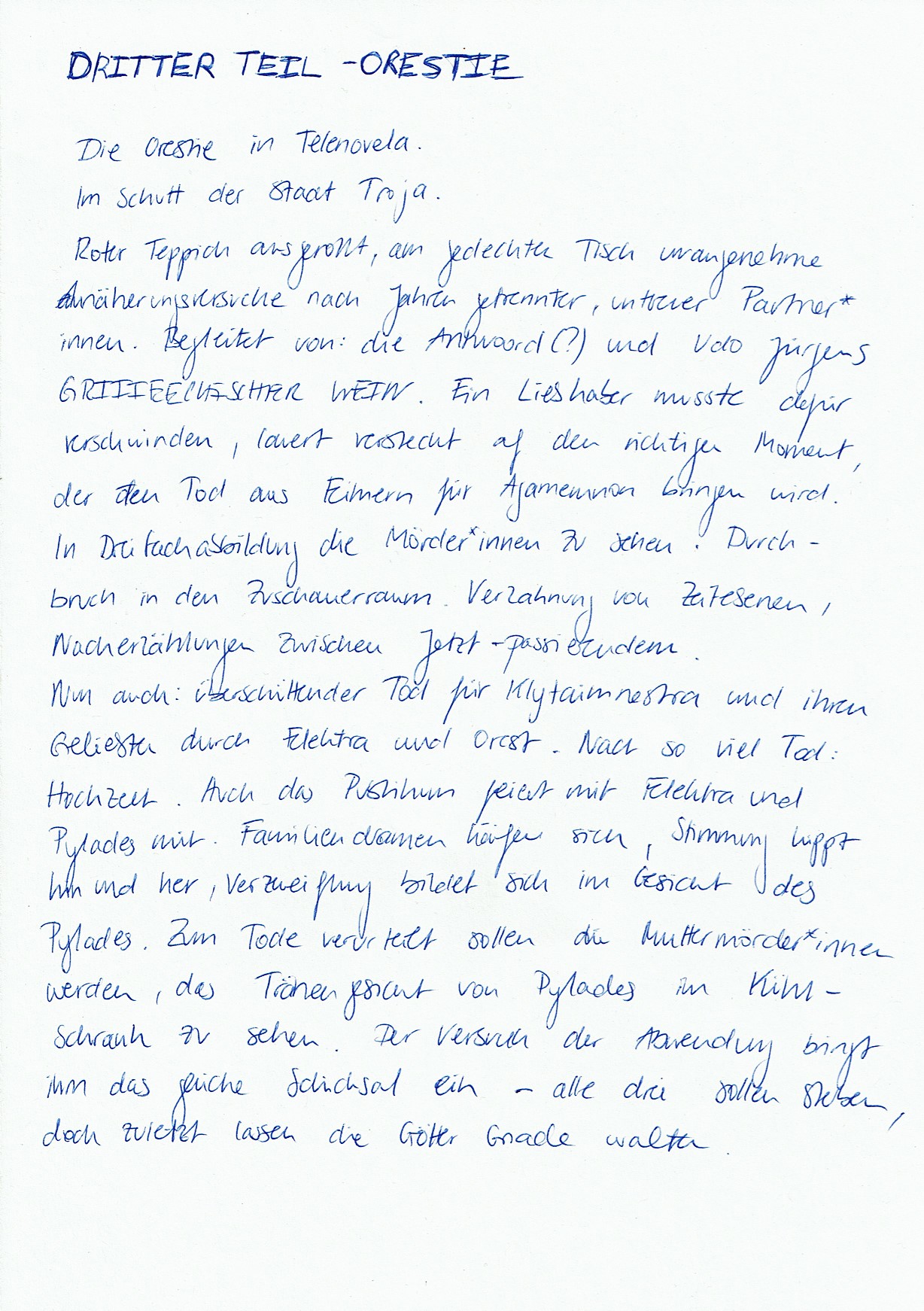
Was Aischylos sehr poetisch in der Orestie beschreibt, nämlich den verhängnisvollen, von den olympischen Göttern gewollten Untergang eines mehrgenerativen Königshauses, ließe sich gegenwärtig vielleicht durch eine Mysterieserie, oder einen Netflix-Thriller „Der Fluch der Atriden“ modernisieren. Christopher Rüping entscheidet sich dagegen für eine Soap-Opera-Version der Orestie. Die Bühne wirkt nach dem Einlass nun wie ein Filmset, in dem die Zimmer des Königshauses recht naturalistisch aufgebaut sind. Natürlich inklusive der für die gesamte Atridenfamilie fatalen Badewanne.

Noch bevor dieses Set bespielt wird, werden die Akteur*innen der Orestie in einem Trailer ähnlich einer Vorabendserie eingeführt. Dass die Handlung in Griechenland spielt, wird durch einschlägige Motive belegt: Flaschenweise Ouzo macht die Runde und das altbewährte, nach griechischem Wein dürstende Udo-Jürgens-Chanson untermalt später eine entgleisende Hochzeitsparty, zu der die Zuschauer*innen munter auf der Bühne lümmeln dürfen.
Die starke konzeptuelle Setzung kann Rüping vor allem durchhalten, weil sein Ensemble aus dem dritten Teil ein Fest des Spielens macht: Wiebke Mollenhauers Elektra bereitet mit irre wissenden Blicken das tödliche Bad, Jochen Nochs Agamemnon erklärt auf Nachfrage, wie es im Krieg denn so gewesen sei, mit unnachahmlicher Schnodderigkeit: Ging so. Seine Gattin Klytaimnestra wird bei Maja Beckmann zur desparate housewife in Dauereskalation. Wenn Nils Kahnwald schließlich splitterfasernackt zwischen den Zuschauer*innen herumtobt, ist die Sache längst von allen guten Geistern verlassen – will heißen: Sehr lustig.
Stimmen aus dem Publikum III
Und doch: Das Potenzial antiker Tragödien verbirgt sich in ihrer Poetik. In der Art, wie Figuren sprechen, wie sie klagen, wie sie schreien. Die Klagelaute fassen den Schmerz in Buchstaben, die Metaphern bebildern das Leid der Figuren. Verzichtet man darauf, skelettiert man den Text auf das Nötigste, öffnet sich die Schlichtheit des äußeren Plots. Diesen Versuch unternimmt Christopher Rüpings Inszenierungsansatz zwar mit sehr eindrücklichem Erfolg, aber spätestens wenn am Ende Apollon als deus ex machina über der Bühne schwebt und gute Neuigkeiten für die Überlebenden der Königsfamilie parat hat, wird deutlich: So ganz zu fassen kriegt man dieses antike Verständnis von Göttern und Menschen, von ihren Handlungen und deren Folgen dann doch nicht. Spaß hat’s trotzdem gemacht.
Die „Orestie“ als Soap? Der Atriden-Horror als große Party? Kaum vorstellbar, dass unser Experte, der Altphilologe Michael Kardamitsis, da mitgeht. Oder etwa doch?
4. Teil: TI TAYTA ΠPO∑ TON ΔIONY∑ON; WAS HAT DAS MIT DIONYSOS ZU TUN?
Aus dem Notizheft
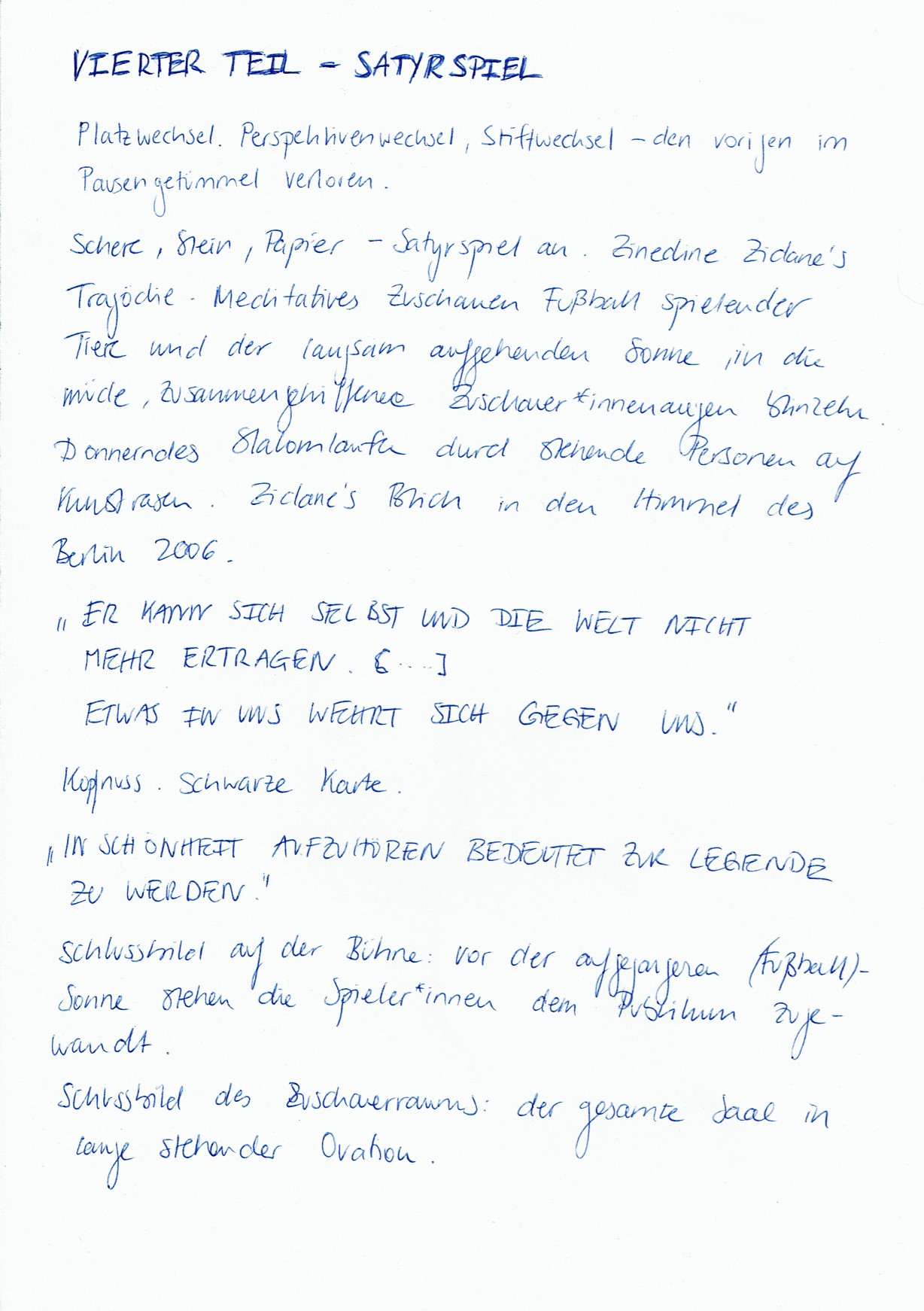
Es gibt ja kaum Schöneres, als Menschen auf der Theaterbühne bei Verrichtungen zuzuschauen, die sie nicht beherrschen. Fußballspielen zum Beispiel. Zwanzig Minuten lang geht es am Ende dieser fast zehn Stunden auf kleinem Feld hin und her. Eine Entkrampfung im Modus des Stolperns und Bolzens. Hundertprozentige Torchancen werden vergeben, falsche Einwürfe sieht man noch und nöcher. Fies nur, wie der wendige Nils Kahnwald seine Kollegen narrt. Hacke, Spitze, Übersteiger. Torerfolge gönnt das mittlerweile leicht angezählte Publikum vor allem den technisch hoffnungslos Unterlegenen.
Nur manchmal geht ein Riss durch dieses Satyrspiel. Dann bleiben die Spielenden wie vom Blitz getroffen stehen, recken die Hälse nach oben, zum Schnürboden. Monitore hängen dort, darauf ein ganz leicht wolkensäumiger, azurblauer Himmel. Nils Kahnwald tritt an die Rampe und erzählt die traurige Legende des größten Fußballers seiner Generation. Denn so, genau so, habe Zinedine Zidane im Endspiel der Weltmeisterschaft 2006 in den Himmel über dem Berliner Olympiastadion geblickt, nachdem er seinen italienischen Gegenspieler Marco Materazzi mit einem wuchtigen, makellos geführten Kopfstoß gegen die Brust niedergestreckt hatte. In der zwanzigsten Minute der Verlängerung. Im letzten Spiel seiner Karriere.

Zidanes Kopfstoß ist eine moderne Ikone. Vielleicht, weil in ihm – wie der Schriftsteller Jean-Philippe Toussaint behauptet, dessen Text „Zidanes Melancholie“ hier gelesen wird – ein Überdruss zur Gewalt geronnen ist. Überdruss am eigenen Talent, an der Mittelmäßigkeit der Anderen, an der Gleichförmigkeit des Daseins überhaupt. Zidane, der Fußball für die Ewigkeit spielte, wollte unterbewusst auch als Ewiger abtreten. Karrieren enden mit Sieg oder Niederlage, von Legenden aber bleibt ein unverdaulicher Rest. Für Zidane war dieser Rest eine Geste jenseits allen Verstandes, jenseits von Gut und Böse. Ein Kopfstoß, mit dem über ihm für alle sichtbar „schwarze Karte der Melancholie aufging“.
So ist auch Zidane einer jener modernen, götterverlassenen Menschen, für deren Tun, Leiden und Lernen die Tragödie keine Begriffe mehr hat. Sie alle sitzen am fast unvergesslichen Ende dieser zehn Stunden beisammen und wärmen sich an einer gewaltigen Sonne, die langsam zum anschwellenden Sog der Musik aus dem Bühnenboden gezogen wird. Gebaut ist sie aus den Trümmern der Geschichte. Auch der neue Tag mag trostlos sein, aber immerhin: Er bricht an.
Die Sonne ist aufgegangen, der Marathon ist überstanden – und fühlte sich doch gar nicht so strapaziös an. Wie lautet das Fazit unseres Experten?
Die letzte Betrachtung gebührt dem Publikum. Es hat mitgewirkt, auf der Bühne geraucht, die Schauspieler*innen wortwörtlich auf Händen getragen und reichlich Ouzo konsumiert. Kurz: Es war großartig.
Ein Applaus für das Publikum!
Ich würde gerne meine Pausenbekanntschaften fragen, ob der gestrige Abend in ihren Träumen auch noch weiter lief. Ich gehe sie im Kopf noch mal durch, meine persönlichen Publikumsgespräche, und bin mir bei allen, bis auf jenes weißhaarige Paar, das ich einmal zwischendurch traf, sicher, dass sie diese intime Frage beantworten würden.
Das weißhaarige Paar würde ich dafür gerne fragen, wie sie den dritten Akt slash die Bühnenparty fanden. Als wir nach dem ersten Teil kurz sprachen, waren sie schon wenig angetan von dem lockerflockigen Umgang mit dem Material und dem lauten Publikumsgelächter. Ich weiß nicht mehr, was ihr Getränk war, würde meine Erinnerung nachträglich aber am ehesten durch Weißweingläser ergänzen. Vielleicht aber auch nur eine verzwickte, phonetische Assoziation, weil ich mir das Paar mit dem Attribut „weißhaarig“ eingeprägt habe. (Sie sind übrigens nicht gegangen und wirkten auf mich aus den Augenwinkeln recht vergnügt in der dritten Pause.)
Gesprochen habe ich auch mit einem „jungen Mann“, wo man nicht weiß, ob man „Junge“ oder „Mann“ sagen soll und dann bei einem geschraubten, eingestaubten „junger Mann“ landet. Der junge Mann, der allein auf einer Bierbank saß (kein Getränk) antwortete auf meine Frage nach seinem intensivsten Theatererlebnis: Gerade eben. Sofort als die Musik anging, ging bei ihm was an und er hat eine halbe Stunde lang geweint, erzählte er.
Und dann waren da die beiden Frauen auf der Hollywoodschaukel. Bestens vertraut mit dem Material, was ich mir, vorurteilsbeladen, wie man eben ist, schon beim Anblick des Reclamheftes gedacht hatte. Aktuell sei der Stoff! Die Überlegung, ob es in einem Krieg überhaupt Gewinnende geben könne. Ob man bei einem Krieg überhaupt von „Gewinnen“ reden könne. „Es geht um Dinge, die immer aktuell sind“, sagt die Frau mit Reclam. „Es wird immer Mütter, Töchter, Väter, Brüder und Kriege geben.“ Das Gespräch machte mir deutlich, dass man gute und richtig gute Entscheidungen treffen kann, bei der Wahl, von wem man sich ins Theater begleiten lässt. Überhaupt: Was wäre diese Inszenierung gewesen ohne die mutigen Bühnenraucherinnen und -raucher, die beim Never-have-I-ever-Spiel eingestanden, schon mal das dritte Rad am Wagen gewesen zu sein. Hier waren sie es definitiv nicht!
Dionysos Stadt
unter Verwendung diverser antiker und anderer Texte
Inszenierung: Christopher Rüping, Live-Musik: Matze Pröllochs, Bühne: Jonathan Metz, Kostüme: Lene Schwind, Dramaturgie: Valerie Göhring, Matthias Pees, Musik: Jonas Holle, Matze Pröllochs
Mit: Maja Beckmann, Peter Brombacher (Jochen Noch), Majd Feddah, Nils Kahnwald, Gro Swantje Kohlhof, Wiebke Mollenhauer, Benjamin Radjaipour.
Premiere am 6. Oktober 2019
Dauer: 9 Stunden, 30 Minuten, 3 Pausen
Text: Lili Hering (1. Teil), Julien Reimer (2. Teil), Antigone Akgün (3. Teil), Janis El-Bira (4. Teil)
Notizheft: Dilan Zuhal Capan
Interview Michael Kardamitsis: Julien Reimer
Text Dionysien: Antigone Akgün
Text Publikum: Jorinde Minna Markert
Publikumsstimmen: Jorinde Minna Markert, Lili Hering
