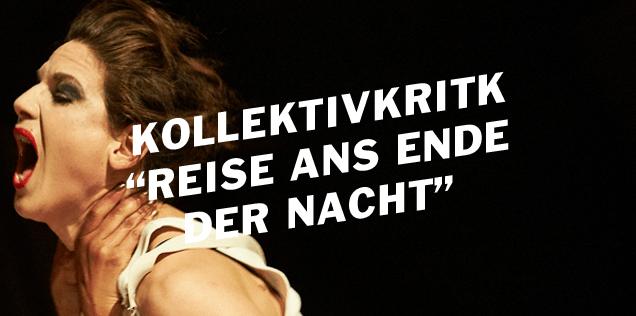„Die Reise ans Ende der Nacht“ nach Louis-Ferdinand Céline
Regie: Frank Castorf
Premiere: 31. Oktober 2013, Residenztheater München
Handlung: episodischer Taumel entlang der Ränder der Gesellschaft
Anzahl der Hühner: eins
Rekordverdächtig: die ersten Zuschauer verlassen nach 22 Minuten den Saal
Nach „Zement“ reiste das Münchner Residenztheater mit „Reise ans Ende der Nacht“ nun ein zweites Mal für das 51. Theatertreffen an. Ein Gastspiel für das Ensemble, ein Heimspiel für den Berliner Intendanten Frank Castorf. Auf der Drehbühne erhebt sich an diesem Abend ein sperriges Barackengerüst mit Holzhütte, Hühnerstall, Küchenzeile und vielem mehr. Über allem ragt eine Leinwand, auf der Filmeinspielungen und Livebilder zu sehen sind (Bühnenbild: Aleksandar Denic). Der Eingang zu diesem heruntergekommenen Abenteuerspielplatz ist mit den Idealen der Französischen Revolution „Liberté, Égalité, Fraternité“ überschrieben, die provokant an die zynische Begrüßungsparole „Arbeit macht frei“ im KZ Auschwitz erinnern. Schon vor Beginn der Aufführung wird die Szenerie somit als trostloses Sinnbild einer Schein-Version von Menschenwürde entlarvt.
Mit „Reise ans Ende der Nacht“ widmet sich Castorf dem 1932 erschienenen Episodenroman von Louis-Ferdinand Céline. Dieser erzählt die Lebensreise des Medizinstudenten Ferdinand Bardamus, der sich 1914 freiwillig zum Kriegseinsatz meldet. Vom Krieg desillusioniert, schlägt er sich nach Afrika durch, wo er das Elend des Kolonialismus erlebt. Eingeborene verschachern ihn nach Amerika, wo er an den Fließbändern der amerikanischen Autoindustrie schuftet. Schließlich kehrt er nach Frankreich zurück und strandet als Armenarzt in einem Pariser Vorort.
Castorf bricht schon zu Beginn mit dem chronologischen Aufbau des Romans. Seine Reise beginnt auf der Überfahrt nach Afrika. Der Ausgangspunkt dieser Reise liegt im Inneren eines ausrangierten Krankenwagens, der irgendwo in einem Bretter- und Wellblechverschlag untergebracht ist und in dem eine hysterische Gesellschaft an einer afrikanischen Patientin herumdoktert. Krank und kaputt ist die Welt, in der das Morden des Ersten Weltkrieges noch im Gange ist und in welcher die eigentliche Apokalypse des Faschismus noch bevorsteht. Kaputt ist aber auch Afrika, das vom Kolonialismus beherrscht wird.
Aus dem Krankenwagen stürzen die Schauspieler voller Intensität auf die Bühne. Ein heilloses Szenengetümmel von nervösem Getrippel und heiserem Geschrei beginnt. Man springt von einer Rolle in die andere. Bibiana Beglau ist die entfesselte Hauptfigur, kurz darauf Spion, Arzt und Arbeiter. Aber auch Franz Pätzold, ein ungestümer Knabe, ist ebenfalls Bardamu und zugleich auch sein Widersacher. Und obwohl es sich von selbst erkennen lässt, dass auf der Bühne nicht hübsch die Chronologie der Ereignisse eingehalten wird, wendet sich Beglau irgendwann von der Rampe aus an das Publikum und betont: „Unsere Reise erfordert Fantasie! Brüche und Sprünge gehören hier dazu!“. Und so entlädt sich der Abend wie eine Irrfahrt auf der Bühne: Wirr und wild, laut und hektisch, anstrengend lang und unvermutet komisch. Eingestreut in die Textvorlage werden vertonte Heiner-Müller-Zitate, darunter der „Engel der Verzweiflung“, gesungen von der Sängerin Fatima Dramé, oder Passagen aus „Der Auftrag“, als harte Blues-Nummer, vorgetragen von Aurel Manthei.
„Reise ans Ende der Nacht“ überzeugt vor allem durch die Kraft des Ensembles. Mit großer Lust gibt es sich Szenen und Aktionen hin, bis sich Bibiana Beglau nach viereinhalb Stunden verträumt durch die gesamte Szenerie in den begeisterten Schlussapplaus tanzt. Wieviel Céline letztendlich von diesem Ereignis in Erinnerung bleibt, ist schwer zu sagen. An einen „Castorf“ erinnert man sich allemal. (David Winterberg)
Bibiana Beglau kämpft sich keuchend durchs Lager, wild getrieben, mit herunterhängender Hose und blechernem Toiletteneimer im Arm. Sie flieht vor der Meute ihrer Kollegen, um schließlich einen Moment Einsamkeit im Kaninchenstall zur Verrichtung ihres Geschäft zu finden. Doch auch hier bleibt kaum Zeit zum Verweilen, denn kurz darauf steht sie bereits voller Energie an der Rampe und zischt mit geschlossenen Zähnen: „Es lebe Frankreich!“ Sie ist rau und wild. Erst nach der ersten Stunde des Fiebertraums schlägt sie leise Töne an und kommt körperlich etwas zur Ruhe. In der Hängematte liegend, träumt sie sehnsüchtig davon, „dass all diese Tage ein Ende nehmen mögen“, und von einer Flucht aus diesem Dschungel, aus diesem Buschwerk, aus diesem Drehbühnenwahnsinn, auf den die goldenen Strahler niederbrennen. Ausweglos erscheint diese Reise, diese Irrfahrt eines Einzelkämpfers, dem Bibiana Beglau ihre Stimme und ihren Körper zur Verfügung stellt. Sie liefert ihren Körper förmlich aus, um dann versoffen und mit heiserer Stimme einzusehen: „Keiner hat Liebe zu verschenken dieser Tage.“ Sie klettert durch Backöfen, verbiegt ihren Körper, trägt die hohen Absätze, als wären sie Kriegsinstrumente. Sie kämpft, krampft und beißt sich durch den Abend – ja man sieht ihr den Ehrgeiz und die Anstrengung bis in die letzte Muskelfaser an. Doch manchmal wirkt das ein wenig zu verbissen, zu sehr gewollt. Und so wartet man oftmals auf die seltenen leisen Momente, in denen sie viel stärker ist, dort wo sie verletzlich ist. Wenn ihre Stimme abreißt, dann erreicht mich Bibiana Beglau mehr, als mit dem lauten Getöne. (Manuel Braun)
Britta Hammelstein ist in diesem wilden und überhitzten Castorf-Abend als liebessehnsüchtige Molly ein beharrlicher Gegenpol zu all den bitteren und kategorischen Absagen an die romantische Liebe. Mit ihrem ganzen Körper, ihrer kraftvollen Stimme, stemmt sie sich gegen den abgestumpften Zynismus, von dem sie umgeben ist. Sie will lieben und geliebt werden, um jeden Preis. In Leon (doppelt besetzt mit Aurel Manthei und Franz Pätzold) scheint sie jemanden gefunden zu haben, der ihr Verlangen stillen kann. Doch er ist ein ewig Suchender, nicht bereit, sich fest an sie zu binden. Gegen Ende des Abends eskaliert der Konflikt zwischen den beiden. Sie sitzen im Taxi, und Leon, mittlerweile regelrecht angewidert von ihrer Liebe, stößt sie ein weiteres Mal rüde von sich, raunt, dass er nichts mehr von ihr wolle, dass ihm alles egal sei. Die ungeschützte Verzweiflung, mit der Britta Hammelstein sich dann gegen diese ganze kalte „Scheiße” aufbäumt, ist sehr berührend und intensiv. Da ist jemand, gefangen in einem falschen Film, voller heißbrennender Liebe unter lauter Gefühlskrüppeln eingepfercht. In dieser Ausweglosigkeit greift Molly nun zur Waffe und schießt Leon nieder. Auch sie ist bereits so sehr vergiftet vom Kreislauf der Brutalität, dass ihr nichts anderes mehr einfällt als zu diesem fatalen Schritt zu greifen. In der kolonialistischen, rassistischen und hysterischen Welt, die Castorfs „Reise ans Ende der Nacht” beschreibt, findet niemand einen Fluchtpunkt. Alle Hoffnung scheint erloschen. Britta Hammelsteins Molly befragt diese Ausweglosigkeit mit aller Vehemenz und setzt dem all ihr Liebesverlangen entgegen, auch wenn der Kampf am Ende verloren gehen wird. Britta Hammelsteins Hingabe an das Ringen dieser Figur um die Liebe in einer kalten, unwirtlichen Welt ist beeindruckend. (Jannis Klasing)
Wo das andere Ende der Nacht liegt
Franz Pätzold war auf einmal da. Nach einer gefühlten Stunde Spielzeit stand er einfach auf der Bühne. Oder hatte ich ihn vorher nur nicht bemerkt, als das Ensemble in den Anfangsszenen gemeinsam lärmend, schreiend durch den Bretterverhau, den Abenteuerspielplatz für energiegeladene Schauspieler, jagte? Das Ipad auf meinem Schoß und unser Twitterexperiment nahmen zu Beginn des Abends den größten Teil meiner Aufmerksamkeit in Anspruch. Wir Twitterer saßen in der letzten Reihe, fünfzehn displayerleuchtete Gesichter. Und dann – nach Bibiana Beglaus Abgang durch die Waschmaschine – stand da auf einmal Pätzold als neuer Ferdinand Bardamu, oder Léon, oder eine Mischung, das wechselte in unberechenbaren Übergängen. Er switchte in rasanter Wendigkeit hin und her, zwischen den Rollen und in den Extremen der beiden Figuren. Der junge Pätzold, das Küken der Truppe, bildete den Gegenpol zur breitbeinigen Männlichkeit Aurel Mantheis und spann auf interessante Weise Beglaus Ferdinand weiter. Pätzold spielte Macker und Ekel: die Hände in den Hosentaschen, lässiges Zurückstreichen seiner Haare, unfehlbarer Ausdruck von Coolness und Mackertum. Eine kleine Wunde auf seinem nackten Oberkörper markierte ihn als gestandenen Krieger. Sein Gesicht allerdings entlarvte ihn als weniger abgebrüht – bei der Entlarvung halfen die Männer, die ihn auch gegen seinen Widerstand mit der Kamera verfolgten und oft so nah wie möglich auf sein Gesicht hielten. Ein schöner Bruch, der mich Bardamu so manchen unerträglichen Ausspruch – mit der Reproduktion von Rassismus und Sexismus wurde in dieser Inszenierung nicht gerade sparsam umgegangen – fast verzeihen ließ. Dann wieder war er nach ein paar flinken Runden durch die gezimmerten Räume mit unzähligen Ein- und Ausgängen oder Öffnungen, die kurzerhand dazu gemacht wurden, ein weinerliches Häuflein. Er krümmte sich in einer der vielen Ecken oder suchte als erblindeter Léon tastend, jammernd die schützende Nähe weiblicher Brüste. Eine Inszenierung, die mich ratlos am anderen Ende der Nacht zurückließ. So viel Energie auf der Bühne – da muss doch etwas Wichtiges gewesen sein, das mir entgangen ist.
PS: Nach der ganzen Kinderbuchdebatte des letzten Jahres, mit exzessivem Gebrauch des N-Wortes, gerne auch auf der Titelseite großer Zeitungen, verstehe ich nicht, warum es so vielen Menschen offensichtlich immer noch so schwer fällt, sich von ihrem lieb gewonnen Recht auf Überlegenheitsgesten in kolonialer Kontinuität zu trennen. Herr Castorf, was gibt Ihnen das? Fühlen Sie sich nur dann wild und frei, wenn Sie dem weißen Publikum mit rassistischen Witzchen ein paar Lacher abringen können?
(Hannah Wiemer)
Bon Voyage, das Leben ist ’ne Reise. Steig einfach ein und es zieht seine Kreise. In turbulenten Kreisen schraubt sich die „Reise durch die Nacht“ hoch. Ein Filmest, und es soll in weiten Teilen ein Film werden, zwischen kongolesischem Township und Detroiter Trailerpark, ist der üppig ausgestattete Austragungsort der Castorfschen Bühnenadaption von Louis-Ferdinand Célines Roman. Ein Roadmovie durch verschiedene Abgründe und Höhenflüge der Existenz, besonders den Facetten der Liebe und der Angst. Trotz hundert Jahre zwischen erzählter und Jetztzeit, ist es eine Konfrontation mit Klischees, die immer noch allzu aktuell sind.
Der Protagonist Ferdinand (Bibiana Beglau), dem wir nich als Soldat im Ersten Weltkrieg begegnen, sondern als Fremdkörper auf einem Schiff nach Afrika, springt durch die Welten: Im kongolesischen Dschungel, in Paris und plötzlich in den USA. Auf einer Leinwand flackert der erste Weltkrieg in einer Rückblende. Ferdinand, der immer wieder von seinem Gefährten Léon Robinson (Aurel Manthei, Franz Pätzold) unterstützt oder heimgesucht wird, irrt von der Angst getrieben durch die Welt. Alle Konstanten scheinen sich abzulösen. Ist Léon schizophren oder ein vielschichtiger, komplexer Charakter? Frank Castorf lässt seine Figuren jedenfalls nicht sie selbst sein, die Charaktere und Schauspieler springen untereinander wild umher. Das Spiel zieht sich oft in die kleinen Buden und Nischen zurück, um dann von mehreren Kamerateams, in oft penetranter Nahaufnahme, auf die Leinwand gebracht zu werden. Diese Nähe ist besonders hilfreich, um das reiche Mienenspiel auch in der letzten Reihe noch verfolgen zu können. Es bringt einen jedoch auch leicht um die Konzentration, wenn das Spiel parallel auf Bühne und Leinwand zu sehen ist. Dabei gibt es aber auch sehr schöne Momente, in denen nicht mehr die Kamera die Handlung verfolgt, sondern die Bühne selbst zum Gegenstand der Beobachtung wird. Die vielen, dekorativen Kleinigkeiten und Zitate an historische Ereignisse, die Aleksandar Denić (Bühne) und Adriana Braga Peretzki (Kostüm) eingebracht haben, erwecken die Lust, durch die Kulisse zu streifen und die Lieben zum Detail zu entdecken. (Felix Ewers)
Nathalie Frank hat eine Skizze von Regisseur Frank Castorf beim Publikumsgespräch angefertigt. Das Twitterexperiment wurde unter dem Hashtag #TTReise geführt.
Beitragsbild: Matthias Horn
Die Berliner Zeitung ist Partner des Theatertreffen-Blogs.