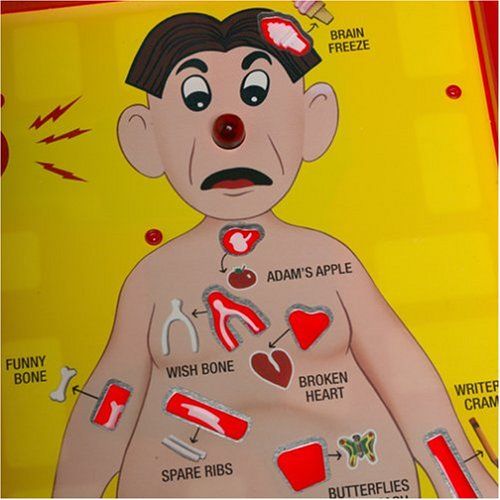Eine Selbstkorrektur zu meiner Haltung gegenüber der Kombination Theatertreffen + politisch
Ich bin eine beleidigte Leberwurst. Gewesen.
Eine schmollende Besserwisserin, die an dieser Stelle fast einen Text veröffentlicht hätte, der sich liest als hätte eine konservative Politikerin mit dem Rotstift das Festivalprogramm traktiert.
Ich war auch durchaus im Traktiermodus. Und zwar so sehr, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass der imaginäre Rotstift zuallererst immer das Format meiner eigenen Gedanken korrigieren sollte. Sowas passiert, wenn man zu müde, zu distanzlos, zu vorurteilsbehaftet, zu gehetzt oder alles zusammen ist, um sein Denken zu reflektieren. Das ist kein Ausnahmefall, sondern gerade eher ein Normalzustand. Es passiert mir mehrmals pro Tag, dass ich mich irre. Das ist nicht schlimm, ich bin lernfähig.
Wenn man allerdings einen Text veröffentlicht, der sich kritisch mit einem Thema auseinandersetzt, sollte man diesen Prozess im Idealfall schon durchlaufen haben. Das Tückische an diesem Prozess ist, dass man nie genau weiß, wann er zuende ist.
Ich dachte bis vor sechs Stunden, dass mein Beleidigtsein genügend Rechtfertigung für die Veröffentlichung eines Texts wäre. Auch deshalb, weil ich wirklich sehr beleidigt war. Der Grund, warum sich meine Augenbrauen seit 15 Tagen immer weiter zusammen schoben, war, dass das Theatertreffen dieses Jahr das Label „politisch“ trägt.
Poli-was?
Man hört jeden Tag überall „politisch“.
Ich hörte parallel dazu immer eine nervtötende Stimme irgendwo aus meinem Inneren, die mich fragt, was sich hinter diesem Begriff eigentlich verbirgt. Eigentlich weiß ichs nicht.
Anstatt mich in eine ausgedehnte Recherche zu vertiefen, habe ich gewartet, bis mir jemand erklärt, was politisch bedeutet. Das ist nicht eingetroffen. Ich wurde ungeduldig, knatschig und habe mich zu der einfachsten Reaktion verleiten lassen, die das Gefühl, ausgeschlossen zu sein, provoziert.
Ich habe dem Theatertreffen die Schuld daran gegeben, dass mir niemand in drei Sätzen darlegen kann, was politisch heißt.
Darauf folgte in meiner logischen Gedankenkonstruktion: Wenn mir niemand erklären kann, was politisch heißt, ist das Theatertreffen vermutlich auch gar nicht politisch. Erschwerend kam meine temporäre Überzeugung dazu, dass es auch nicht sein kann, dass ein Wort in unterschiedlichen Diskursen und Disziplinen auftaucht, weil es dann anscheinend alles bedeuten kann.
Angefangen mit der Auftaktveranstaltung mit Nicolas Stemanns Inszenierung von „Die Schutzbefohlenen“. Anschließend daran Tischgespräche zur Inszenierung mit Schauspieler*innen, Zuschauer*innen und Expert*innen zum Thema Flüchtlingsbewegung. Darauffolgend „Say it loud, say it clear…!“, ein Thementag zu Flucht, Einwanderungspolitik und Asylgesetzgebung. Dann die Eröffnung vom Stückemarkt, dessen Stückeauswahl eine gemeinsame politische Tendenz auszeichnen sollte. Nach fast jeder Vorstellung wird der Aufruf zur Spendenkampagne „My right is your right“ verlesen, die sich für den Wiederaufbau der Flüchtlingswohnstätte am Oranienplatz engagiert. Es folgt das Abschlussgespräch zum Stückemarkt „Politisches Schreiben heute“. Etwas später das Symposium zum Thema Fassbinder „Das Private ist politisch!“. Anschließend eine Diskussionsrunde zu „Kunst der Rebellion, Rebellion der Kunst“. Weiter geht‘s mit „Wer sind wir in der weißen Welt? – Theater und Postkolonialismus“. Abschließend die Podiumsdiskussion „Angst im Betrieb”. Da sind jetzt zum Theatertreffen eingeladene Inszenierungen wie „Common Ground“, „Warum läuft Herr R. Amok?“ gar nicht erwähnt. Oder alles, was zum Focus Fassbinder gespielt wird. Obwohl man sie mit dem Attribut „politisch“ versehen könnte.
Diskursives 14-Gänge-Menü
Dieses Programm ist so gehaltvoll wie ein 14-Gänge-Menü und meine Kritik an dieser Bandbreite war nichts anderes als die Beschwerde darüber, dass nicht alles gleich schmeckte.
Ich wollte Eindeutigkeit. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es mir ungemein geholfen hätte, dieses Programm zu verdauen. Umso mehr unterschiedlicher Input mein Hirn an die Grenzen seiner Rechenleistung brachte, desto mehr sehnte ich mich nach einem Verdauungsschnaps. Am besten soviel Schnaps, dass ich wieder vergesse, was gesagt wurde.
Warum entwickelt man einen Widerstand gegen unterschiedliche Perspektiven auf den Begriff politisch?
Weil politisch für mich immer mit der Vorstellung davon zu tun hat, wie und was man am Vorhandenen ändern möchte.
So falsch lag ich damit gar nicht. Für politisch gibt es keine eindeutigere Begriffsdefinition als „die Politik betreffend“. Eine von sehr vielen Definitionen für Politik:
„Politik ist ein schwer zu umgrenzender Begriff, der im Kern seiner Bedeutung die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen bezeichnet. Sehr allgemein kann jegliche Einflussnahme, Gestaltung und Durchsetzung von Forderungen und Zielen in privaten oder öffentlichen Bereichen als Politik bezeichnet werden.“
Sehr klar umgrenzen kann ich, welche dieser Begriffe in mir den Wunsch nach Eindeutigkeit ins Absurde katapultiert haben. Die Durchsetzung von Forderungen und Zielen durch verbindliche Entscheidungen. Durchsetzen heißt nicht nur Zuhörerin von spannenden Diskursen zu sein, sondern plötzlich auch Mitarbeiterin auf vielen unterschiedlichen Baustellen, die immer mehr wurden. Zur gleichen Zeit wurde mein Gefühl, Entscheidungen treffen zu können, immer weniger. Die Worte „verbindliche Entscheidung“ schreien außerdem fast: Mach bloß keinen Fehler, überleg lieber dreimal!
Das Interessanteste an diesen Denkvorgängen ist, dass ich mich selbst längst mit dem Theatertreffen verwechselte. Sonst hätte ich überhaupt nicht darüber nachdenken brauchen, ob ich verbindliche Entscheidungen treffen kann und will.
Sowas nennt man Distanzverlust.
Ich doch nicht…
Das wäre der Moment gewesen, mir einzugestehen, dass mich die Informationsfülle überfordert und ich nicht in der Lage bin, alle Diskurse so schnell zu verarbeiten, dass ich eine eigene Position in jedem Einzelnen beziehen könnte. Das wäre auch der Moment gewesen, in dem ich zu meiner temporären Kritikunfähigkeit stehe.
Man kann allerdings auch eine Pseudodistanz aufbauen, indem man sein eigenes Problem jemand anderem zuschreibt.
In der Wirklichkeit meiner beleidigten Weltsicht fehlte also nicht mir, sondern dem Theatertreffen die Position. Ich warf dem Theatertreffen vor seine politische Haltung an Aktualitäten wie die Flüchtlingsthematik zu knüpfen. Entweder, oder, hörte ich mich sagen. Aber nicht so zwischendurch mal politisch und nächstes Jahr dann postpolitisch. Später fand ich mich zustimmend nickend auf der Diskussion zum Thema „politisches Schreiben heute“ wieder.
Warum? Weil es eigentlich um das politische Potential von Text gehen sollte, aber schon nach zehn Minuten niemand mehr über Text sprach. Weil die Essenz der Diskussion darin lag, dass auch der politischste Umgang mit dem Text nicht genügen kann, wenn sich nicht auch die Strukturen innerhalb der Institution Theater ändern und wenn man sich nicht um Schwellenabbau bemüht. Denn selbst wenn man die Heterogenität der Institution Theater vorraussetzt, also unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Perspektiven dort arbeiten, dann sollte das auch für das Publikum zutreffen. Das hat dazu geführt, dass ich eine Armee von bestätigenden Ausrufezeichen in meinen Mitschrieben anhäufte. Nicht nur, weil ich diese Überlegungen alle wertvoll finde. Sondern, weil ich gefühlt die Verantwortung abgeben konnte. Ich dachte, das Theatertreffen soll erstmal selber seiner Verkündigung zum Thema „politisch sein“ gerecht werden, bevor es sich das Label politisch anheften kann. Das ist teilweise richtig, aber größtenteils bequem. Und zwar von mir.
17 Tage politisch?
Was kann eine siebzehntägige Veranstaltung wie das Theatertreffen hinsichtlich des Labels politisch eigentlich konkret leisten? Es kann Forderungen und Ziele indirekt formulieren, indem es in unterschiedlichen Diskussionen zum Nachdenken darüber anregt. Es kann unterschiedliche Inszenierungen einladen, die den Begriff „politisch“ im weitesten Sinne tangieren und damit zeigen, welche Bandbreite er hat. Es kann zum Spenden aufrufen und sich damit teilweise dem Vorwurf entziehen, dass auf solchen Veranstaltungen sowieso nur geredet wird und es nicht zur Umsetzung des Geredes kommt. Die Umsetzung von Diskursen beschränkt sich während des Festivalzeitraums auf Aktionen, die innerhalb von siebzehn Tagen getätigt werden können. Man kann in zweieinhalb Wochen wahrscheinlich nur schwer die Struktur einer Institution verändern.
(Längerfristig gibt es andere Möglichkeiten über deren Einlösung man aber vom jetzigen Zeitpunkt aus nichts sagen kann.)
Wenn ich meinen eigenen Gedanken weiterspinne und beim Einfordern von eindeutigen Zielen bleibe, verlange ich nichts anderes von dieser Kulturveranstaltung, als dass sie ein Parteiprogramm aufstellt. Das ist absurd, warum sollte ich das wollen? Weil ich in eine fiese Falle getappt bin, die im Kontext von Politik sehr verführerisch ist. Ich erwarte ein Parteiprogramm, weil ich Lösungen erwarte.
Damit wäre der Kern meines Problems freigelegt.
Ich war tatsächlich beleidigt, weil das Theatertreffen die Probleme, die es thematisiert, weder löst noch mir eine eindeutige Anleitung zur Verfügung stellt, wie ich das tun könnte.
Anfang vom Anfang
Ein ganz guter Vergleich dazu ist ein Zitat von Annemarie Matzke (Gründungsmitglied von She She Pop und Dozentin an der Universität Hildesheim) während der Diskussion „Schauspielkunst oder Jetztzeitforschung? Die Schauspielausbildung der Zukunft.“
Ein Schauspielstudium, sagt Annemarie Matzke, kann Studenten nicht auf etwas vorbereiten, das sich ununterbrochen im Wandel befindet, aber es kann den kritischen Blick der Studenten auf die Institution Theater schärfen und die Frage aufwerfen „Wie wollen wir arbeiten?“. Es geht gar nicht vorrangig darum, Schauspieler*innen auszubilden, sondern viel mehr Performer*innen, die sich als die Person begreifen, die sie spielen. Performativ heißt, dass man sich des eigenverantwortlichen Anteils des Spiels bewusst ist und sich immer wieder fragt: Wen spiele ich? Was ist meine Verantwortung hier auf der Bühne? Stehe ich für das ein, was ich sage? Das ist ein politischer Vorgang.
Die Bühne ist nochmal ein anderer Raum als die Sitztribüne vor dem Podium.
Ich bin aber wirklich einige Tage herumgeschmollt und habe eine klare (Regie-)Anweisung erwartet. Solche Sinneswandel habe ich sonst selten. Solche Sinneswandel sind auch nicht ganz ungefährlich.
Der Vorgang der Selbstreflektion, und nichts anderes ist es, was Annemarie Matzke beschreibt, braucht aber Zeit. Zeit, die unentbehrlich ist, um zu überprüfen, ob man tatsächlich für das einsteht, was man sagt oder schreibt. Zeit, die nötig ist, um Strukturen in Institutionen zu erkennen und zu verändern. Zeit, um zu festzustellen, dass es keinen Sinn macht, einem Festival vorzuwerfen, dass es den Begriff „politisch“ an Aktualität und nicht Kontinuität knüpft. Siebzehn Tage geben kaum Raum für Kontinuität. Diejenige, die ich zur Kontinuität auffordern kann, bin ich selber. Alles andere fällt auch auf mich zurück. Das ist hier alles nur ein Anfang vom Anfang. Mehr kann es auch nicht sein.